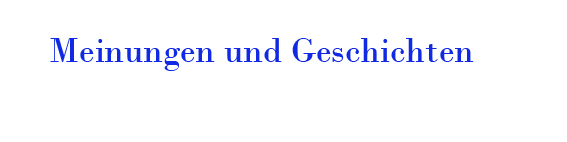
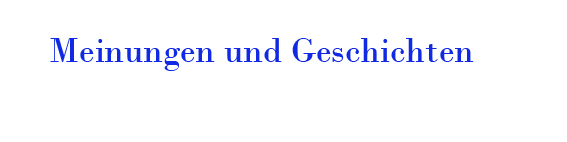
Prof. Dr. Helmut Reichling zu Themen von gestern, heute und morgen
aktualisiert am: 16.07.2019

zur besseren Lesbarkeit bitte die Druckversion wählen
![]()
Warum
stirbt die Innenstadt?
Prof. Dr.
Helmut Reichling, Hochschule Kaiserslautern, Mittelstandsökonomie
Kleine, inhabergeführte Geschäfte, einesneben dem anderen, in liebevoll restaurierten Altbauten, die ganze
Einkaufsstraße entlang. Dazwischen Cafés und Bistros mit Sonnenschirmen und Sesseln
unter breiten Schirmen, darum herum Bäume und gepflegte Blumenbeete und
natürlich überall freundliche und fachkundige Bedienungen, möglichst ohne
Mittagspause und bis 21 Uhr.
Ein Paradies für fröhliche Flaneure
und Shopper in Kauflaune.
Das Idealbild einer lebendigen
Innenstadt.
Die Realität in den meisten Klein-
und Mittelstädten sieht meist ganz anders aus:
Die Seitenstraßen vermitteln mit
verlassenen Ladengeschäften eine trostlose Atmosphäre, die Leerstände breiten
sich immer mehr auch in Richtung Zentrum aus. Mancherorts ragt sogar noch ein
ehemaliges und rapide verfallendes Warenhaus mit verhängten Fenstern in das
düstere Ensemble von Spielhallen, Wettbüros und Kleinpreisgeschäften hinein.
In den Kernzonen der Innenstädte,
heute normalerweise Fußgängerzonen, haben Filialisten mit standardisiertem
Warenangebot die angestammten Familienbetriebe verdrängt, deren Inhaber
schlussendlich noch über jeden passablen Mieter für ihre Immobilie froh waren. Optiker,
Akustiker, Bäckereien und Apotheken prägen die Einzelhandelslandschaft, ergänzt
durch Telefonläden, Shishabars und Dönerbuden.
Das sogenannte Einkaufserlebnis hat
sich längst auf die grüne Wiese oder in die Malls[1] der Großstädte
verlagert.
Jedes Mal, wenn ich zu
Begutachtungen oder Beratungen in eine Stadt komme, bietet sich mir quer durch
Deutschland das gleiche Bild. Dabei höre ich immer wieder dieselben Klagen der innerstädtischen
Geschäftsleute: Die Innenstadt stirbt.
Die Verantwortlichen in den
Kommunen haben die Probleme längst erkannt. Meistens wird der Erfolg oder
Misserfolg der Stadtführung daran gemessen, wie belebt die Innenstadt noch ist
und wie der Niedergang gestoppt werden kann.
Viele Bürgerinnen und Bürger, die
über ihre sterbende Innenstadt klagen, meinen nur ihre eigene Stadt wäre
betroffen. Sie suchen die Schuldigen in der Kommunalpolitik und sehen dabei
nicht, dass es sich bei dem Tod der Innenstädte um ein epidemisches Phänomen
handelt. Auch die Nachbarstädte, auch solche Städte, die noch als Vorbild
genannt werden, sind vom Virus befallen.
Die Probleme sind überall gleich,
und in allen Gesprächen höre ich Klagen darüber, wie hausgemacht das Sterben
der Innenstadt sei.
Von den innerstädtischen
Einzelhändlern kommt in allen Städten mit schöner Regelmäßigkeit das Argument
der schlechten Parksituation. Die vorhandenen Parkplätze seien entweder zu
wenig, zu weit entfernt oder zu teuer.
Die Klagen über die Konkurrenz auf
der sogenannten grünen Wiese sind weitgehend verstummt, wahrscheinlich weil die
betroffenen Einzelhändler schon gar nicht mehr existieren. Seit einigen Jahren
wird stattdessen über die Online-Konkurrenz geklagt und zwar mit den gleichen
Argumenten, mit denen früher schon das Kaufverhalten der Kunden kritisiert
wurde. Es wird Beratung im Fachhandel erwartet, gekauft wird beim
Fachdiscounter (früher) oder beim Online-Versand (heute).
Von Seiten der Kunden wird
bemängelt, dass es keine schönen individuellen Geschäfte mehr gebe, nur noch
Filialisten mit überall gleichem Sortiment. Es lohne sich nicht mehr zum
Einkaufen in die Innenstadt zu gehen, weil dort nichts Attraktives mehr zu findet
sei, der Einkauf in der Innenstadt biete kein Erlebnis mehr und zudem fehlten einheitliche
Öffnungszeiten.
Nicht wenige fordern sogar die
Ansiedelung eines großen Warenhauses als Frequenzbringer in der Innenstadt und
sehen dabei nicht, dass die Zeit der mächtigen Kaufhauskonzerne als
Innenstadt-Magneten längst abgelaufen ist. Die traditionellen Warenhäuser
sterben auch in den Großstädten aus wie die Saurier der Urzeit.
Spricht man mit den
Verantwortlichen in den Kommunalbehörden, dann wird über den Konkurrenzdruck
der Nachbarstädte geklagt, über deren Ansiedlungspläne großflächiger
Einzelhandelsbetriebe, über die innerstädtischen Hausbesitzer, die nicht bereit
sind, Abstriche von ihren Mietvorstellungen vorzunehmen und lieber eine
Immobilie leer stehen lassen als sie einem Existenzgründer zu günstigen
Konditionen anzubieten.
Diese Begründungen für das Sterben
der Innenstadt sind aus Sicht der Betroffenen durchaus verständlich, dennoch
gehen diese Argumente am Problem vorbei.
Die eingangs beschriebene schöne
Innenstadt ist ein Idealbild, das sich so nicht mehr zurückholen lässt. Je mehr
die Innenstädte sterben, umso lieblicher erscheinen den älteren Kunden die
Erinnerungsbilder der Stadt „wie sie früher einmal war.“
Aber wie war es früher wirklich? Um
die gegenwärtige Situation richtig zu beurteilen und die künftige Entwicklung
sicher zu prognostizieren, sollte ein kurzer Blick auf die geschichtliche
Entwicklung unserer Innenstädte geworfen werden.
Zu Beginn jener Epoche, welche die
Historiker industrielle Revolution nennen, als immer mehr Menschen aus den
ländlichen Gegenden in die heutigen Klein- und Mittelstädte zogen, sahen die
Innenstädte ganz anders aus als wir uns das heute im Jahr 2019 vorstellen.
Den innerstädtischen Mittelpunkt
bildeten immer noch die Kirche oder die Kirchen, der Marktplatz und das
Rathaus. Es gab enge Straßen und einige wenige Ausspann-Gasthöfe, in denen die
Bauern anhielten, wenn sie „in die Stadt“ kamen. Um diese zentralen Gebäude herum hatten sich
Handwerker mit ihren Ladengeschäften niedergelassen: Bäcker, Metzger,
Schuhmacher, Schneider sowie einige wenige Läden mit Artikeln des täglichen
Bedarfs, wie „Kolonialwarenhandlungen“, die Luxusartikel anboten, welche nicht
auf dem Marktplatz zu kaufen waren: Kaffee, Tee, Tabakwaren, Gewürze,
Schokolade und dergleichen. Mit im Zentrum war natürlich auch die Apotheke
beheimatet. Es gab eine oder mehrere Eisenwarenhandlungen mit
landwirtschaftlichen Geräten, aber auch Haushaltswaren wie Töpfe, Messer,
Bestecke und Geschirr. Selbst Schlittschuhe und Petroleumlampen gab es beim
Eisenwarenhändler, der zudem die Schlosser und Schmiede der Stadt mit
„Grobeisen“ versorgte.
Allmählich entstanden in den folgenden
Jahrzehnten sogenannte „Einkaufsstraßen“, meist die Hauptstraße einer Stadt und
die angrenzenden Straßen. Neue Geschäftshäuser wurden gebaut, mancherorts auch
richtige mehrstöckige „Kaufhäuser“ überwiegend mit Textilien, Glas, Porzellan,
Keramik und weiterem Haushaltsbedarf. Zu den Handwerksbetrieben kamen
Ladengeschäfte mit industriell gefertigten Waren, neben den Schuhmacher der
Schuhladen, neben den Schneider das Modegeschäft. Aus den traditionellen
Kolonialwarenläden wurden Süßwaren-, Kaffee- und Teegeschäfte,
Tabakwarenhändler und Schreibwarengeschäfte. Für den gehobenen Bedarf der
städtischen Kundschaft siedelten sich Modistinnen, Büchsenmacher, Photographen,
Goldschmiede und Bijouterie- Geschäfte an. Spielwarenläden, Papeterien und
Buchläden vervollständigten das Angebot für das Bürgertum. Studierte Apotheker,
die nach den damaligen strengen Rechtsverordnungen keine Genehmigung zur
Eröffnung einer zusätzlichen Apotheke erhielten, machten sich als Drogisten
selbständig.
Denkt man sich jetzt noch das
Amtsgericht, die Ordinationen der Allgemeinärzte, die Kanzleien der
Rechtsanwälte und Notare, diversen Cafés und Restaurants hinzu, dann haben wir
schon das historische Bild einer Einkaufstadt um 1900, deren Zentralität weit
ins ländliche Umland hineinreichte. Parkplatzsorgen waren unbekannt, da der
motorisierte Verkehr kaum eine Rolle spielte.
Mancherorts hat sich diese Struktur
noch bis über die beiden Weltkriege und in die fünfziger Jahre gehalten. In den
Großstädten und den bevölkerungsreicheren Mittelstädten begann die Erosion der
mittelständisch geprägten Ladenstraßen jedoch bereits viel früher. Mit dem
Aufkommen des Einzelhandelsbetriebstyps des Kaufhauses und des Warenhauses war
schon gegen Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts das Schicksal der
kleinen Ladengeschäfte und der handwerksnahen Einzelhandelsbetriebe besiegelt.
In den besten Einkaufslagen
entstanden mehrstöckige Warenhäuser, ursprünglich Kaufhäuser für Textilwaren,
die sich rühmten, alle Sortimente unter einem Dach anzubieten, von der
Bekleidung bis zu Haushaltswaren und Lebensmitteln. Die bedeutendsten
Warenhäuser wirkten als wahre Einkaufspaläste nach französischem Vorbild in
jeder Großstadt als Attraktion und lockten aus dem weiten Umfeld die Kunden in
die Metropolen.
In gleichem Stil, nur etwas kleiner,
entstanden mehrstöckige Kaufhäuser auch in den Mittelstädten.
Die Eigentümerfamilien der großen
Warenhausunternehmen konnten bald den größten Teil des Umsatzes der umliegenden
kleinen Ladengeschäfte aufsaugen und errichteten in weiteren Städten
Warenhäuser nach dem bewährten Muster.
Damals begann das erste
„Einzelhandelssterben“ in den Innenstädten und fatalerweise waren es gerade
weitblickende und kapitalstarke jüdische Kaufmannsfamilien, die den damals
modernen Typ des filialisierten Warenhauses entwickelten. Nicht wenige in ihrer
Existenz bedrohte mittelständische Ladenbesitzer glaubten daher den Versprechen
der nationalsozialistischen Propaganda, „die jüdischen Kapitalisten aus
Deutschland zu entfernen“. Ihnen gefiel das Motto „Deutsche kauft nicht bei
Juden“ und in ihrer Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin waren es nicht zuletzt
diese konservativ bürgerlichen Kreise, die vom Nationalsozialismus ihre Rettung
vor den Großbetrieben erhofften.
Diese Hoffnung wurde, wie wir
wissen, gründlich enttäuscht.
Auch die kleinen Geschäfte des
Mittelstandes versanken gemeinsam mit den „arisierten“ Warenhäusern im Schutt
der zerbombten Innenstädte.
Die bereits erwähnte kurze
Renaissance der Innenstädte in den fünfziger Jahren war dem Wiederaufbau nach
dem Krieg geschuldet. Zum einen versuchten die mittelständischen Händler, die
den Krieg im wahrsten Sinne des Wortes überlebt hatten, ihre Geschäfte am alten
Standort wiederaufzubauen. Oft war ihnen von ihrer Vorkriegsexistenz nichts
anderes mehr geblieben als das Trümmergrundstück. Im Wiederaufbau wurden so die
alten Ladenstraßen belebt und die Schaffung von Parkplätzen für die
motorisierte Kundschaft war kein Problem dem besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden musste. Die sogenannten Wirtschaftswunderjahre mit dem Überhang der
Nachfrage über das Angebot und mit stabil steigenden Preisen ermöglichte es
fleißigen Kaufleuten, sich wieder mit ihren Geschäften zu etablieren.
Zudem begünstigte ein
soziologisches Phänomen die kleinteilige Entwicklung der innerstädtischen
Einzelhandelslandschaft dieser Zeit: Viele Männer waren gefallen. Die
verwitweten und überwiegend noch jungen und zuvor nicht berufstätigen Frauen
waren nun gezwungen, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. In der
Zeit vor dem Krieg war die weibliche Erwerbstätigkeit nicht ansatzweise so
entwickelt wie heute im Jahr 2019, in dem weit mehr als zwei Drittel aller
Frauen zwischen 25 und 55 Jahren ihren Lebensunterhalt aus eigener
Erwerbstätigkeit bestreiten.
Von den betroffenen Frauen
verfügten nur wenige über eine Berufsqualifikation in handwerklichen Bereichen,
zum Beispiel als Photographinnen, Schneiderinnen oder Köchinnen. Also blieb die
Büroarbeit oder die Beschäftigung im Einzelhandel.
Daher übernahmen viele Frauen die
Geschäfte ihrer gefallenen Männer oder sie wagten selbst mit eigenen Ladengeschäften
den Schritt in die Selbständigkeit. So entstanden Lebensmittelgeschäfte,
Schreibwarenläden, Blumen- und Geschenkartikelgeschäfte und andere
Einzelhandelsbetriebe des täglichen Bedarfs.
Diese Geschäfte waren zumeist
innenstadtnah und relativ klein. Das Erscheinungsbild des vielzitierten „Tante
Emma Ladens“ ist dieser Periode zuzuordnen.
Diese schönen kleinen „Tante Emma
Läden“ von denen viele schwärmen, obwohl sie allenfalls in ihrer Jugend nur
noch vereinzelt welche gesehen haben, ist ein typisches Nachkriegsphänomen und
war von Anfang an nicht langfristig überlebensfähig.
Der Kostenfaktor, der sich im
Einzelhandel am schnellsten verteuerte, war das Personal. Konnten sich viele
Familienbetriebe noch durch rigorose Selbstausbeutung und weitgehendem Verzicht
auf fremdes Personal über Wasser halten, erzwangen in den siebziger und
achtziger Jahre die verfeinerten Kundenbedürfnisse und die Nachfrage nach einer
größeren Sortimentsbreite die Einzelhändler zu strukturellen Anpassung.
In den Branchen mit Produkten des
täglichen Bedarfs und geringer Handelsspanne musste der teurere Kostenfaktor
Personal durch den weniger teuren Kostenfaktor „Fläche“ ersetzt werden. Mit dem
Aufkommen von Selbstbedienung und Ausgangskassen im Lebensmitteleinzelhandel
entwickelten sich die Supermärkte in den Innenstädten. Oft in ehemaligen Kinos,
Immobilien die nach der Verdrängung des Kinos durch das Fernsehen preiswert
anzumieten waren.
Um mit den Wünschen der Verbraucher
nach Angebotsvielfalt und günstigen Preisen mithalten zu können, reichten bald
die aus heutiger Sicht bescheidenen Flächen dieser Supermärkte nicht mehr aus.
Billige Flächen standen allerdings im innerstädtischen Bereich nicht zur
Verfügung und so entstanden die großflächigen Einzelhandelsbetriebe auf der
sogenannten grünen Wiese, also in der Regel weit außerhalb der Innenstädte mit
großem Parkplatzangebot und bester Verkehrsanbindung. Die zunehmende Mobilität
der städtischen Bevölkerung begünstigte diesen Strukturwandel.
Der Auszug aus der Innenstadt vollzog
sich zwischen 1980 und 2000 in verschiedenen Schüben. Zuerst zogen die
Lebensmittelanbieter auf die grüne Wiese und dann nach und nach alle wichtigen
Branchen. Aus den ursprünglich auf Lebensmittel ausgerichteten
Verbrauchermärkte[1]
wurden bald SB-Warenhäuser als sogenannte Vollsortimenter. Sogar die Bau- und
Möbelmärkte bieten heute an ihren Standorten außerhalb der Innenstädte ein
sogenanntes Randsortiment an, das bis zu zehn Prozent des Gesamtangebotes
ausmacht und angesichts der Umsatzgröße dieses großflächigen Einzelhandels mehr
Umsatz auf sich vereinigt und aus der Stadt abzieht als viele mittelständische
Betriebe in der Innenstadt aufweisen.
Zusammenfassend erkennen wir für
das Sterben der Innenstädte zunächst drei Gründe:
1. Die
steigenden Personalkosten zwingen die Firmen dazu Personal durch Fläche zu
ersetzen. Der Kunde ist bereit, Tätigkeiten, die früher das Verkaufspersonal
übernommen hat im Rahmen der Selbstbedienung selbst zu erledigen. Dazu muss die
Ware für den Käufer im Geschäft erreichbar sein und in den benötigten Mengen
für alle Kunden zur Verfügung stehen. Um dies zu gewährleisten bedarf es großer
Flächen, die innerstädtisch nicht zur Verfügung stehen.
2. Durch
größere Mobilität ist der Kunde bereit, großflächige Einzelhandelsbetriebe am Stadtrand
aufzusuchen.
3. Die
großflächigen Einzelhandelsbetriebe entwickeln sich immer mehr zu
Vollsortimentern[2]
, auch wenn sie ursprünglich als Fachmärkte konzipiert waren.
Um die städtische
Einzelhandelssituation und ihre Dynamik weiter zu beleuchten dürfte auch ein
Blick auf die Discounter hilfreich sein.[3]
Die ersten Discounter tauchten nach
den Supermärkten schon relativ früh in den Innerstädten auf. Durch
Selbstbedienung, primitivste Ladenausstattung und Warenpräsentation, durch
Verzicht auf Frischware und die Beschränkung auf umschlagstarke Artikel
zeichneten sich diese Einzelhandelsbetriebe durch hohe Preisaggressivität
aus. Heute sind die Discountfilialisten
oder die Discount-Tochtergesellschaften der Einzelhandelsketten gehobener
ausgestattet als bei der Einführung dieses Einzelhandelstyp. Ihre Stärke ist
aber nach wie vor die Sortimentsbeschränkung auf schnelldrehende Artikel und
die Preisattraktivität in der Sonderangebotspolitik.
Wegen ihres geringeren
Flächenbedarfes finden sich die Discounter meist in den Gewebezonen kleinerer
Ortschaften und in den Wohnbereichen der Mittel- und Großstädte, also nicht im
Zentrum.
Durch das Aufkommen von sogenannten
Fachdiscountern, z.B. für Werkzeuge oder Elektronische Medien, wanderten
weitere Einzelhandelsangebote vom Stadtzentrum in die städtische Peripherie.
Wie schon vermutet schöpft der
Online-Handel mittlerweile über 5 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes ab,
Tendenz steigend. Besonders betroffen
sind dabei die innerstädtischen Anbieter von elektronischen Geräten, Büchern
und Textilien. In manchen Sortimentsbereichen wird bereits ein Viertel der
Umsätze über den online-Handel und nicht mehr in der Stadt getätigt.
Nach diesen Betrachtungen über die
aktuelle Einzelhandelslandschaft wundert es nicht, wenn die Innenstädte
sterben.
In den Großstädten entsteht ein
Einkaufserlebnis durch Malls, Galerien und durch einzelne, hochexklusive
Einzelhandelsbetriebe die mit extrem hochpreisigem Angebot noch in der Lage
sind, Mieten und Personalkosten zu erwirtschaften.
Nur ganz vereinzelt finden wir in
der Bundesrepublik Deutschland noch Einkaufsstraßen wie die eingangs
beschriebenen, mit vielen kleinen inhabergeführten Geschäften und individuellen
Angeboten unterschiedlichster Sortimentsbereiche. Fast ausschließlich handelt
es sich dabei um historische Städte mit einer intakten Altstadt und einer hohen
Frequenz an Touristen und Tagesbesuchern.
Im Übrigen ist die Innenstadt der
meisten Städte in Agonie, im Koma oder schon tot.
Alle noch so engagierten Bemühungen
lokaler Wirtschaftsförderungsvereine oder Händlervereinigungen werden den Tod
der Innenstadt nicht verhindern, ja nicht einmal hinauszögern.
An dieser Stelle der Überlegungen
müssen wir uns fragen wie sehen die Innenstädte der Zukunft aus:
Im schlimmsten denkbaren Fall
sterben die Städte von innen nach außen, also ebenso wie sie historisch
gewachsen sind:
Das Zentrum wird zunehmend
unattraktiv als Wohnbereich, hohe Mieten stehen der abnehmenden Wohn- und
Verkehrsqualität diametral gegenüber. In mittelgroßen Städten wird das
etablierte Bürgertum in die Randgebiete abwandern, die Wohngebäude im Zentrum
werden nicht mehr modernisiert und mit zunehmendem Verfall sinkt der Ertragswert
und das Milieu der dortigen Mieter. Es entstehen Ghettos von „Neubürgern“ in
den ehemaligen Geschäftsstraßen, bei gleichzeitigem weiterem Verfall der
eingesessenen Einzelhandelsbetriebe. Nach und nach werden die Seitenstraßen der
Innenstädte zu „No Go Arias“. Am Ende
dieses Horrorszenarios wuchern soziale Brennpunkte rund um unbesuchte Kirchen.
Wir lässt sich aus der Sicht der
Mittelstandsökonomie und der langfristigen Stadtplanung diese Entwicklung
umkehren?
Ich bin der Meinung, ein denkbarer
Weg besteht darin, den Innenstädten ihre ursprüngliche Funktionalität
zurückzugeben. Die Entwicklung der Innenstädte nicht auf die
Einkaufsmöglichkeiten zu fokussieren, sondern auf ihre traditionelle Funktion
als Begegnungstätte von Bürgerinnen und Bürgern.
Diese Sicht der Stadtentwicklung
ist weniger eine Aufgabe der sogenannten kommunalen Wirtschaftsförderung,
sondern einer planmäßigen Inszenierung der Innenstadt.
Wir früher steht im Zentrum der
neuen Entwicklung der „Marktplatz“ der in allen Städten noch vorhanden ist.
Hier müssen die Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, auch wenn sie nicht mehr
in der Innenstadt einkaufen. Dieser zentrale Platz muss regelmäßig mit
„Feierabend-Veranstaltungen“, „Stadtfesten“, „Bürger- und Begegnungsfesten“
bespielt werden.
Rund um diese Plätze müssen in Form
von Cafés, Bistros und Kneipen weitere attraktive Begegnungsstädte für alle
Alters- und Einkommensschichten entstehen. Ebenso muss die Stadt im Rahmen
ihres kulturellen Potentials innenstädtische Schwerpunkte in Form von Museen,
Ausstellungen, Galerien und Büchereien setzen.
Diese Innenstadtkonzepte dürfen
keinesfalls zu großflächig angelegt sein, sondern müssen sich auf das Zentrum
konzentrieren. Im Rahmen einer langfristig angelegten Kommunalpolitik sollte
die „Rekultivierung“ der Innenstadt so geplant werden, dass dieses Projekt
seiner Bezeichnung auch gerecht wird: Nicht der Einzelhandel steht im
Vordergrund, sondern das „kulturelle Erlebnis Stadt“.
In vielen deutschen Großstädten mit
gewachsenen oder initiierten innerstädtischen Erlebniswelten, rund um
historische, sanierte Quartiere oder geeignete Gewässer, können solche Begegnungszonen
mit guter Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Bevölkerung
unabhängig vom Einkaufstrend geschaffen werden. Voraussetzung dafür ist der
politische Wille zum Umdenken und die notwenige Finanzausstattung der Projekte.
In Klein- und Mittelstädten stellt
sich das Problem etwas anders dar: Die kommunalpolitisch Verantwortlichen
müssen einsehen, dass die Innenstadt als Einzelhandelsgebiet ihrem Ende
entgegengeht. So schwer es auch fällt und so schmerzlich es für die Betroffenen
ist. Alle Kraft muss jetzt auf die Inszenierung der traditionellen Innenstadt
als Begegnungsraum gelegt werden. Die städtische Wirtschaftsförderung muss ein
langfristig ausgerichtetes „Quartiermanagement“ betreiben, in dessen
Mittelpunkt der Service- und Eventgedanke steht. Existenzgründungen im Bereich
der Gastronomie und der Kleinkunst dürfen keinesfalls durch allzu lange
Behörden- und Bewilligungswege erschwert werden. In die Konzeptentwicklung sind
alle sozialen Gruppen der Stadt einzubinden: Zuerst die politischen Parteien,
die ansiedlungswilligen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Vereine und
Bürgerinitiativen und nicht zuletzt die Kirchen, mit ihren nach wie vor
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten.
Konzeptentwürfe sollten in diesem
Rahmen allerdings keinesfalls zerredet, sondern zielstrebig und mit Nachdruck
von der jeweiligen Stadtspitze durchgesetzt werden.
Freilich ist dies keine leichte
Aufgabe, bei der Rückschläge oft unvermeidbar sind. Dennoch erscheint es mir
der einzige Weg aus dem Tod der Innenstädte wieder eine Chance zu machen.
[1)
Großflächiger (1.500-5.000 qm) eingeschossiger Einzelhandelsbetrieb in
Selbstbedienung.
[2]
Vollsortimenter in diesem Sinne sind Einzelhandelsbetriebe, die nicht nur ein
tiefes und breites Angebot in ihrem branchentypischen Leistungsprogramm haben,
sondern durch ausgebaute Randsortimente ein umfassendes bedarfsorientiertes
Leistungsprogramm ausweisen, z.B. Lebensmittel, Getränke, Zeitschriften usw. im
Baumarkt.
[3]
Discounter sind einzelhandelsbetriebe mit relativ schmalen und flachen
Sortiment das auf hohen Warenumschlag abzielt. Im Vergleich zum großflächigen
Einzelhandel kleinerer aber intensiv genutzter Verkaufsfläche.
[1] Malls sind großflächige
Einzelhandelszentren, bei denen in einem Gebäude mehrere Anbieter
zusammengefasst sind. Es soll der Eindruck einer Einkaufsstraße mit mehreren
kleinen Geschäften entstehen. Sie sind meist in den 1A Lagen von Großstädten
anzutreffen. Mieter in Malls sind in der Regel Filialisten